Warum die Sprache auf Gott hinweist…

Rolf Marcel Fischer
veröffentlicht am 1.4.2025
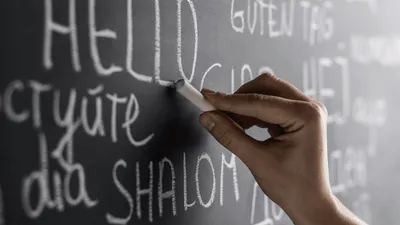
Sprache als essenzieller Teil unseres Seins
Ich spreche jeden Tag. Ich lese jeden Tag. Sprache ist ein wesentlicher Teil unserer Gesellschaft, unserer Existenz, ja gar unseres Seins. Sprache ist so essentiell, dass wir uns aufgrund der Sprache nicht einmal mehr von ihr distanzieren können. Sie ist einfach da. Du glaubst mir nicht? Versuche mal eine Sache zu verstehen ohne auf die Verwendung von Sprache zurückzugreifen. Für einen erwachsenen Menschen beinahe undenkbar, aber offensichtlich funktioniert es: Kinder erforschen und entdecken so die Welt. Es gibt schließlich auch Tiere, die sich der Welt intelligent nähern können. Oktopusse zum Beispiel sind zu erstaunlichen Dingen fähig, beherrschen aber keinerlei Sprache.
Die Grenzen und Möglichkeiten menschlicher Sprache
Ich sage also nicht, es wäre nicht möglich. Ich sage nur, dass ein Mensch, einmal der Sprache mächtig, innerhalb der Grenzen seiner Sprachfähigkeit gefangen ist: Eine Person kann sich nur insofern mitteilen, wie sie die eigene Sprache beherrscht. Sie, die Sprache, dient der Kommunikation und verbindet einen Menschen mit einem anderen. Auf basalem Niveau ist dies nicht zwingend notwendig: Ich kann auch meinem Hunger in Südkorea Ausdruck verleihen, ohne ein einziges Wort koreanisch zu sprechen: Trotzdem wird mein Gegenüber schnell erkennen, dass ich Hunger habe.
Aber je komplexer eine Unterhaltung wird oder je komplexer ein gesellschaftliches Gefüge wird – sozial, historisch, ökonomisch, juridisch, technologisch – desto komplexer müssen die sprachlichen Muster werden, um diesen Entwicklungen Rechnung tragen zu können.
Auch das Christentum basiert wesentlich auf Sprache und hat zur Entwicklung der Sprache enorm beigetragen: Wenn es um die Entwicklung der Sprache geht, um die Übersetzungen und Verbreitungen der Bibeln oder in ihren philosophischen, musikalischen und anderen künstlerischen Ausdrucksformen.
Gott als Ursprung der Sprache und des Logos
Biblisch gesehen, hat die Sprache, hat das Wort eine nicht zu hoch einzuschätzende Bedeutung: Gott spricht den Himmel und die Erde ins Dasein. Natürlich hat Gott im eigentlichen Sinne als immateriellen Wesen keine Stimmbänder (wir lassen Jesus Christus als hypostatische Union der menschlichen und göttlichen Natur kurz außen vor…) und hat nicht sprichwörtlich ins Nichts „gerufen“. Nein, es geht hier um die Schöpfung der Welt durch den reinen Akt des Willens und nicht durch Gewalt, wie es die Götter der antiken Welt angeblich getan haben sollen.
Dennoch ist das Wort bedeutend: Christus ist dem Johannesprolog folgend, der Logos, das Wort. Doch auch dieses Wort hat weit mehr Bedeutung als nur diese: Sinn, Vernunft, Struktur, Wort, Lehre und sagt damit nicht nur über die Herrlichkeit und Bedeutung Christi viel aus, sondern auch in unendlich abgeschwächter Weise etwas über uns und unser „Wort“: Durch das Wort erkennen, beschreiben, re-konstruieren und strukturieren wir die uns begegnende Wirklichkeit. Sprache (und Schrift) ist unsere Art der Wirklichkeit verstehend zu begegnen.
Denken wir an die Bibel, das geschriebene Wort Gottes; Wie bedeutend und komplex es wird, wird deutlich, wenn wir die simple Frage stellen, was es denn bitte meint, die Bibel sei das Wort Gottes? Was genau ist das Wort Gottes? Das Buch? Die Tinte auf dem Papier? Die Worte, die geschrieben sind? Und in welchem Sinne wäre sie das Wort Gottes? Nicht alles, was in der Bibel steht, ist Spruch des HERRN, was also meint Wort Gottes auf die ganze Schrift bezogen? Das allein wäre ein dutzend Artikel wert, aber mein Punkt ist folgender: Das Christentum lebt zutiefst aus dem Logos: ontologisch also wesensmäßig, metaphorisch und pragmatisch. Ohne das Wort wäre nichts.
Doch dieses Wort, kann es neben seiner theologischen Bedeutung auch einen apologetischen Wert haben? Nicht allein dadurch, dass wir, ich, diesen Artikel gerade schreibend, und Du, diesen Artikel gerade lesend, die Notwendigkeit und Bedeutung von Sprache im reinen Sosein beweisen, sondern auch in ihrem Wesen ein Indiz für die Tatsächlichkeit Gottes sein könnte?
Dieser Artikel will in verschiedenen Schritten das Wesen und die Prämissen analysieren unter denen Sprache nicht nur an sich strukturiert ist, sondern auch jene, unter denen sie auch funktioniert. Schließlich soll dargelegt werden, wie eben jene Axiome und Prämissen allein durch Sprache nicht widerlegt werden können und klar auf etwas hinweisen, was wir Gott nennen würden. Abschließend wird ein Syllogismus präsentiert und auf die apologetische Brauchbarkeit geprüft.
Sprache als rationales und strukturiertes Phänomen
Betrachten wir kurz das Phänomen Sprache: Jede noch so rudimentäre Sprache besitzt Struktur. Diese Struktur mag schwierig und historisch gewachsen und verflochten sein, aber sie ist strukturiert und folgt somit einem rationalen Muster: Sie ist vernünftig. Aber vor allem setzt sie etwas grundlegenderes voraus: Ich spreche, kann Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft auf einer Metaebene im Geist vergegenwärtigen und in einer mir bekannten Sprache strukturiert beschreiben und kann mir unter konventiellen Bedingungen sicher sein, dass ein Gegenüber zumindest grundlegend erkennen und verstehen kann, was ich auszudrücken wollte. Mein Geistesakt muss also nicht nur mit der Sprache vernünftig und strukturiert kontinuierlich korrelieren, sondern auch mit dem Geistes- und Sprechakt einen anderen Gegenüber und setzt voraus, dass diese Person dieses auch verstehen kann. Dies verbindet mich mit der Wirklichkeit und jeden anderen Menschen mit meinem Geist und mit der Gesamtheit des uns zugänglichen Wirklichen. Dass allein macht schon ein passables Argument für Gott, aber es ist nicht alles.
Wahrheit, Wahrnehmung und die objektive Wirklichkeit
Das Sprechen an sich setzt voraus, dass alle Menschen in den Grundzügen die Wirklichkeit ähnlich wahrnehmen: Unsere Wahrnehmungen mögen aufgrund anderer historischer, sozialer und kultureller Parameter variieren, aber diese geschehen dann erst auf der Ebene der Deutung der Wirklichkeit: Ob ich zum Beispiel vor einer Tarantel wegrenne oder sie als ungefährlich oder gar kulinarisch genießbar ansehe, hängt von diesen sozio-kulturellen Faktoren ab. Aber dass alle Beteiligten ein achtbeiniges, schwarzes Geschöpf sehen, welches wir mit dem Wort Spinne bezeichnen, ist allen gemein. Dies wiederum setzt voraus, dass es so etwas wie gemeinsame Wahrnehmung im Geiste und eine Objektivität der Wirklichkeit gibt, die wir mittels Sprache beschreiben.1
Das reine Verwenden der Sprache – auch wenn ich gar nicht anders kann – setzt also implizit voraus, dass Sprache tatsächlich Wirklichkeit beschreiben kann: Natürlich in den sozio – kulturellen Begrenzungen, in denen Sprache Dingen jenseits des eigenen Einflusses und auch Bewusstseins Dingen und Phänomen Bedeutung und Konnotationen gibt. Auch ist eine Sprache an sich selbst gebunden: Eine Sprache kann nur das beschreiben, was in ihrem Kulturkontext existiert und innerhalb dieses sozio-kulturellen Kontext zu beschreiben ist. Beispiel: Solange keine Vorstellung von Außerirdischen existiert, gibt es auch kein Wort dafür es zu beschreiben. Zudem ist Sprache in selbst eine Art ontologischer Krüppel: Durch die Begrenztheit der Sprache und der Worte mag ein Wort vielseitig ein oder mehrere Phänomene beschreiben, doch kann kein Wort allein jemals ein Phänomen in Gänze beschreiben. Je komplexer und fundamentaler ein Phänomen zu sein scheint, desto komplexer werden unsere sprachlichen Beschreibungen, welche per Definition unzureichend sind. Dies gilt für die komplexen Phänomene des Kosmos, aber auch das Leben selbst spricht diese Sprache: Es gibt einen Grund, warum über wirkliche Liebe nur in Bildern gesprochen werden kann; Es beschreibt ein Phänomen, über welches durch kein Wort deskriptiv adäquat gesprochen werden kann.
Die Grenzen von Sprache und das Paradoxon der Zeit
Sprache hat also Grenzen: Ihre ontologischen Grenzen, die Grenzen ihrer eigenen Geschichte, ihres Entstehungs- und Sprachraums und ihrer eigenen Struktur. Aber sie kann Wirklichkeit beschreiben. Ganz offensichtlich, sonst würde unsere Gesellschaft binnen Stunden zusammenbrechen, wäre es nicht so. Sie beschreibt sämtliche Gesetze und Phänomene der Natur oder ermöglicht, dass die Schönheit eines Musikstückes oder Gedichts auch Jahrhunderte später nicht demonstriert werden kann.
Aber Sprache tut noch etwas viel Grandioseres: Sie vermag etwas Ausdruck zu verleihen, was eigentlich undenkbar ist: Vergangenheit und Zukunft. Sie vermag das Gestern Wirklichkeit werden zu lassen. Doch wie? Was ist denn bitte Gestern? Hat es einen ontologischen Status? Gibt es überhaupt so etwas wie Gestern, außer, dass es gewesen ist? Ist das Gestern mehr als die Beschreibung des Vergangenen? Gerade noch war es jetzt und selbst das Jetzt beschreibt etwas, was so richtig gar nicht existiert und un-fass-bar ist. Oder gar die Zukunft? Ein Beispiel: Ich werde morgen gegessen haben. Existiert dieser Satz in der Wirklichkeit? Es gibt (jetzt) gar keine Zukunft, oder doch? Was gibt Sprache die Möglichkeit etwas zu formulieren, was in unserer Wahrnehmung eigentlich gar nicht existiert, aber doch beschrieben und ausgedrückt werden kann? Sind solche Sätze ohne sinnvollen Inhalt? Dann wäre der große Teil unseres Sprechens bedeutungslos. Das kann man so sehen, aber viel mit dem tatsächlichen Phänomen Leben hat es jenseits des philosophischen Diskurses nicht.
Wenn also Sprache ist, und mit mir, meinem Mitmenschen, mit der Wirklichkeit und sogar mit der Vergangenheit und mit der Zukunft verbindet und diese auszudrücken vermag, was gibt dieser ontologische Fundierung?
Woher kommt die Wirklichkeit des Vergangen, des Gegenwärtigen und des Zukünftigen? Wir können sie nicht garantieren oder gewährleisten. Wir sind Teil dieses Hamsterrades und unfähig es zu verlassen. Eigentlich bräuchte die gesamte Wirklichkeit, welche offensichtlich durch Sprache funktional und adäquat erfasst werden kann, eine ontologische Fundierung in einer Wirklichkeit, in der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft gleichsam wirklich und gegenwärtig sind. Damit Sprache also funktionieren kann, und sie funktioniert, muss also das Undenkbar wirklich sein: Es bräuchte, damit Sprache funktioniert, wie sie funktioniert, eine ewige Wirklichkeit, einen Geist, in dem die Wahrheit und Tatsächlichkeit des Wirklichen fundieren und gründen. Es bräuchte einen ewigen, allgegenwärtigen, allwissenden, unglaublich intelligenten und rationalen Geist, in dem der Ursprung der Wahrheit der Wirklichkeit, des Erkennens und Sprechens abgesichert ist: Es bräuchte den ewigen Logos, die ewige Vernunft. Es bräuchte Gott.
An Weihnachten haben wir die Fleischwerdung eben jenen unvergänglichen Geistes gefeiert: Jesus Christus.
Zusammenfassung und Syllogismus
Ich habe versucht darzulegen, wie Sprache zutiefst von objektiver und ewiger Wahrheit, von einer rationalen Struktur des Geistes und der Wirklichkeit lebt und ihr Sosein diese auch nicht widerlegen kann. Sie verweist durch ihre reine Struktur und Funktionalität auf die Wirklichkeit Gottes und kann mittels ihrer eigenen Struktur diese auch nicht leugnen oder widerlegen.
Will man es in einem Syllogismus zusammenfassen, könnte diese so aussehen:
Prämisse 1: Sprache ist strukturiert, rational und ermöglicht die Beschreibung von Wirklichkeit.
(Beobachtung: Ohne Struktur und Rationalität könnte Sprache keine Wirklichkeit erfassen oder kommunizieren.)
Prämisse 2: Damit Sprache funktioniert, setzt sie eine objektive Wirklichkeit voraus, die von allen Sprechenden zumindest grundlegend erkannt und geteilt werden kann.
(Beobachtung: Ohne eine gemeinsame Grundlage der Wahrnehmung wäre Sprache bedeutungslos.)
Prämisse 3: Sprache ermöglicht die Darstellung von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, die ontologisch nicht direkt greifbar sind.
(Beobachtung: Zeit wird durch Sprache erfasst, obwohl sie selbst in ihrer Natur transzendent erscheint.)
Prämisse 4: Die Struktur, Rationalität und Funktion von Sprache setzen eine absolute Quelle voraus, die Wahrheit, Ordnung und Sinn garantiert.
(Beobachtung: Ohne eine solche Quelle wäre die Konsistenz von Sprache und die Erfassbarkeit der Wirklichkeit nicht erklärbar.)
Conclusio: Die Struktur, Funktion und Existenz der Sprache weisen auf eine transzendente, ewige Quelle hin – den Logos. Dieser Logos, in dem Wahrheit, Ordnung und die Einheit von Zeit und Wirklichkeit gründen, ist Gott.
Zusammengefasst:
Solange Sprache existiert, zeigt sie mit ihrer Struktur und ihrer Verbindung zur Wirklichkeit unweigerlich auf den ewigen Ursprung: Gott selbst.
Apologetische Brauchbarkeit: Sprache als Bastion Gottes
Das Argument der Sprache ist an sich simpel, aber in seinen Tiefenstrukturen sehr in sprachphilosophischen und erkenntnistheoretischen Gedanken verwurzelt. Eben diese können es erst schwierig und unzugänglich erscheinen lassen, doch hat man es einmal verstanden, ist dieses Argument unglaublich stark und nur schwierig zu widerlegen.
Die einzige Kritik, die vorgebracht werden kann, ist die der Zirkularität: Ich nehme an Wahrheit existiert, um Wahrheit zu beweisen. Wie aber zu beweisen war, ist die reine Formulierung dieser Kritik sich selbst widerlegend und bringt den wesentlichen Punkt des Arguments umso stärker zur Geltung: Man kann durch die Sprache nicht die Funktionalität und Axiome widerlegen, auf denen Sprache baut: Die Frage ist nur die: Verweist die Funktionalität, Struktur und Rationalität der Sprache nicht sich selbst auf Gott, ja, setzt diesen eigentlich im Kern schon voraus?
Ich glaube, das Sein und die Struktur der Sprache und der Akt des Sprechens und Schreibens ist eine beinahe Bastion für die Existenz Gottes: Solange Grammatik existiert, bleibt sie immer ein riesen Pfeiler mit der Aufschrift: Hello, it is me, God.
Also ja, es ist ein spannendes und wirksames, wenn auch schwieriges Argument, welches in seinem Kern aber leicht zu verstehen und zu verwenden ist.
Glossar:
Logos: Ein Begriff aus der griechischen Philosophie und Theologie, der "Wort", "Sinn" oder "Vernunft" bedeutet. Im christlichen Kontext bezieht er sich auf Jesus Christus als das personifizierte Wort Gottes.
Ontologie: Ein Bereich der Philosophie, der sich mit dem Wesen des Seins und den grundlegenden Strukturen der Wirklichkeit beschäftigt.
Grammatik: Die Lehre von den Regeln und Strukturen einer Sprache, die den korrekten Gebrauch von Wörtern und Sätzen bestimmt.
Apologetik: Ein Teilgebiet der Theologie, das sich mit der Verteidigung und Begründung des Glaubens gegenüber Kritikern auseinandersetzt.
Hypostatische Union: Ein theologischer Begriff, der die Vereinigung der göttlichen und menschlichen Naturen in der Person Jesus Christus beschreibt.
Ontologische Grenzen: Die Beschränkungen, die sich aus der Natur des Seins und der Existenz ergeben, insbesondere in Bezug auf das, was erkannt oder beschrieben werden kann.
Sprachphilosophie: Ein Zweig der Philosophie, der die Natur, den Gebrauch und die Bedeutung von Sprache untersucht.
Erkenntnistheorie: Ein Bereich der Philosophie, der sich mit der Natur, den Quellen und den Grenzen des Wissens beschäftigt.
Transzendent: Ein Begriff, der etwas beschreibt, das jenseits der normalen physischen Erfahrung oder des Verständnisses liegt; oft verwendet, um das Göttliche oder Übernatürliche zu charakterisieren.
Objektivität der Wirklichkeit: Die Annahme, dass die Realität unabhängig von individuellen Wahrnehmungen oder Meinungen existiert und beschrieben werden kann.
1 Natürlich schafft Sprache auch Wirklichkeit: In einem Fußballspiel sind Worte des Schiedsrichtern ent-scheidend. Aber auch die sozialen und kulturellen Historien prägen die Bedeutung von Worten und somit auch im Vorhinein die Wahrnehmung dessen, der mittels dieser Begriffe der Wirklichkeit begegnet. Sprache ist ein genauso fragiles und unzureichendes, wie präzise logisches Instrument der Kommunikation.