Mehr als Materie – Eine christliche Antwort auf den Naturalismus (1/3)

Kevin Gaa
veröffentlicht am 30.4.2025
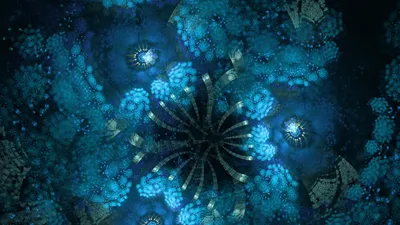
1. Einleitung: Warum überhaupt über den Naturalismus nachdenken?
Was, wenn unsere Überzeugngen gar nicht auf Wahrheit ausgerichtet sind – sondern bloß das Ergebnis von Prozessen, die einzig auf Überleben zielen? Diese Frage klingt zunächst abstrakt, berührt aber einen Punkt, der für jeden relevant ist: Können wir unseren eigenen Gedanken trauen? Und wenn nicht – was bedeutet das für alles, was wir über die Welt, über uns selbst und über das, was wir für wahr halten, glauben?
In diesem Artikel geht es genau um diese Spannung. Schritt für Schritt wollen wir untersuchen, ob bestimmte weltanschauliche Grundannahmen – insbesondere der Naturalismus – am Ende das untergraben, worauf sie sich selbst stützen: nämlich die Verlässlichkeit unseres Denkens.
2. Begriffserklärung und zentrale Konzepte
2.1 Naturalismus
Was ist eigentlich Naturalismus? Philosophinnen und Philosophen – sowohl aus der Vergangenheit als auch der Gegenwart – tun sich bekanntermaßen schwer damit, den Begriff „Naturalismus“ eindeutig zu definieren. Dennoch hat sie das nie davon abgehalten, es immer wieder zu versuchen. Eine mögliche Annäherung ist die Definition über das Physikalische. Der Materialismus vertritt die These, dass alles, was existiert, letztlich aus Materie besteht. Doch das Universum besteht nicht nur aus Materie. Es gibt auch physikalische Kräfte – etwa Gravitation oder Elektromagnetismus – die bestimmen, wie sich die Materie verhält. Diese Kräfte wiederum bestehen selbst nicht aus Materie. Deshalb ist der Begriff „Physikalismus“ weiter gefasst als Materialismus: Er schließt nicht nur materielle Dinge ein, sondern auch physikalische Prozesse und Interaktionen.1
Der Naturalismus geht noch einen Schritt weiter und ersetzt den Begriff „physikalisch“ durch „natürlich“. Alles, was existiert, sind natürliche Entitäten und Prozesse. Im Allgemeinen besagt der Naturalismus, dass „die Wirklichkeit vollständig durch die Natur erschöpft ist, also nichts ‚Übernatürliches‘ enthält, und dass alle Bereiche der Wirklichkeit mit wissenschaftlichen Methoden erforscht werden sollten.“2 Es überrascht also nicht, dass der Naturalismus Atheismus impliziert. Damit steht aber mehr auf dem Spiel, als es auf den ersten Blick scheint. Denn wenn die Welt rein naturwissenschaftlich erklärbar ist, stellt sich die Frage, ob für Dinge wie Bedeutung, Moral oder Bewusstsein noch Platz bleibt – oder ob sie letztlich nur als Nebenprodukte betrachtet werden können. Genau hier beginnen die tiefergehenden Konsequenzen solcher Grundannahmen sichtbar zu werden. Um das besser zu verstehen, lohnt es sich, einen Schritt zurückzugehen und zu fragen, wann Überzeugungen überhaupt tragfähig sind. Denn aus naturalistischer Sicht lässt sich die gesamte Wirklichkeit auf natürliche Entitäten und physikalische Prozesse reduzieren, also auf all das, was die Naturwissenschaft bereits beschreibt. Der Philosoph Graham Oppy konkretisiert die Definition des Naturalismus noch weiter: Es gibt keinen Gott und keine Götter3, und das Bewusstsein ist vollständig das Ergebnis biologischer Evolution bzw. ein kausales Produkt solcher Organismen.4 Eine noch differenziertere Definition des Naturalismus werden wir im weiteren Verlauf dieses Artikels erarbeiten. Doch zunächst wollen wir den Begriff „Selbstwiderlegung“ klären.
2.2 Selbstwiderlegung
Um das Konzept der Selbstwiderlegung zu verstehen, schauen wir uns zunächst einige Beispiele an. Im Folgenden finden wir eine Liste von Aussagen, die sich selbst widersprechen bzw. selbst widerlegen:
- Alle Überzeugungen sind unzuverlässig. Wenn alle Überzeugungen unzuverlässig sind, dann ist auch die Überzeugung, dass alle Überzeugungen unzuverlässig sind, selbst unzuverlässig. Der Anspruch ist somit selbst ungültig.
- Logik ist ungültig. Wenn Logik tatsächlich ungültig wäre, könnten wir weder der Aussage „Logik ist ungültig“ vertrauen noch sie logisch überprüfen. Die Aussage widerlegt sich damit selbst.
- Wissenschaft ist die einzige Quelle von Wissen. Diese Aussage ist etwas kniffliger – sehen wir uns an, warum. Sie behauptet, dass wir nur durch Wissenschaft zu echtem Wissen gelangen können. Alles außerhalb der Wissenschaft – wie Philosophie, Geschichte, Logik oder Erinnerung – zählt demnach nicht als wahres Wissen. Das große Problem dabei ist: Diese Aussage selbst ist kein wissenschaftlicher, sondern ein philosophischer Satz – genauer gesagt ein erkenntnistheoretischer. Sie trifft nämlich eine Aussage darüber, wie Wissen überhaupt möglich ist, nämlich dass jegliches Wissen ausschließlich wissenschaftlichen Ursprungs sein könne. Da die Untersuchung von Wissen selbst in den Bereich der Erkenntnistheorie fällt, kann diese Aussage nicht mithilfe wissenschaftlicher Methoden überprüft werden. Die Wissenschaft wiederum setzt die Gültigkeit von Logik und Erkenntnistheorie bereits voraus, um überhaupt sinnvoll funktionieren zu können. Mit anderen Worten: Wir können kein naturwissenschaftliches Experiment – etwa im Labor – durchführen, um festzustellen, ob diese Aussage wahr oder falsch ist. Der Anspruch ist somit selbst ungültig.
- Worte haben keine Bedeutung. Diese Aussage besteht aus Worten. Wenn Worte jedoch tatsächlich keine Bedeutung hätten, dann hätte auch diese Aussage keine Bedeutung – und wäre somit selbstwiderlegend.
- Es ist moralisch falsch, andere zu verurteilen. Diese moralische Behauptung ist selbst ein Urteil über andere. Wer diese Aussage trifft, tut also genau das, was er oder sie als moralisch falsch bezeichnet.
Wer davon ausgeht, dass unsere Überzeugungen letztlich auf etwas Verlässliches zurückgehen, wird hier stutzig – denn solche Aussagen untergraben genau diesen Grundanspruch. Wenn selbst grundlegende Aussagen über Logik, Wahrheit oder Bedeutung sich selbst aufheben, dann wird es schwierig, überhaupt sinnvolle Kommunikation oder Erkenntnis zu begründen. Das zeigt, wie wichtig ein stabiles Fundament ist, auf dem Denken überhaupt möglich wird. Ohne so ein Fundament ist selbst Skepsis nicht mehr glaubwürdig.
2.3 Selbstwiderlegung (Fortsetzung)
Für die Zwecke dieses Artikels ist es auch notwendig, eine etwas komplexere Form der Selbstwiderlegung zu betrachten, um uns auf das Argument in Abschnitt 2 vorzubereiten. Nehmen wir folgende Aussage: „Alle deine Überzeugungen sind das Ergebnis psychologischer Prägung aus Kindheit und Jugend, gesellschaftlicher Normen, elterlicher Einflüsse und unbewusster Vorurteile.“ Es stimmt, dass viele unserer Überzeugungen entweder direkt oder indirekt durch solche Faktoren beeinflusst werden. Und es ist sicherlich auch richtig, dass Menschen Überzeugungen oft nicht durch rationales Abwägen bilden, sondern sie vielmehr passiv aus ihrem Umfeld übernehmen. Wenn wir jedoch aufmerksam sind, erkennen wir sofort das Problem dieser Behauptung: Wenn *alle* Überzeugungen das Ergebnis irgendeiner Form von Konditionierung sind, dann muss auch die Person, die diese Behauptung aufstellt, genau zu dieser Überzeugung konditioniert worden sein.
Ein nützlicher Hinweis, um selbstwiderlegende Aussagen zu identifizieren, besteht darin, nach Begriffen zu suchen, die Absolutheit oder Allgemeingültigkeit andeuten. Wörter wie „alle“, „nur“, „ungültig“, „ist“ oder „kein“ sind meist erste Anzeichen dafür. Der effektivste Weg, eine selbstwiderlegende Aussage zu erkennen, besteht jedoch darin, die Aussage einfach auf sich selbst anzuwenden – und zu prüfen, ob sie dem eigenen Maßstab standhält. Dieses Vorgehen nennt man einen selbstreferenziellen Test. Nehmen wir dazu folgende Aussage: „Alle Aussagen sind relativ.“ Wenn alle Aussagen relativ sind, dann muss auch diese Aussage relativ sein. Wenn sie relativ ist, dann ist sie nicht allgemein gültig – was bedeutet, dass manche Aussagen absolut sein müssen. Aber wenn manche Aussagen absolut sind, dann ist die Aussage „alle Aussagen sind relativ“ falsch.
Dabei ist es wichtig zu betonen, dass nicht jede Aussage, die Allgemeingültigkeit oder Absolutheit suggeriert, sich zwangsläufig selbst widerlegt. Nehmen wir zum Beispiel: „Alle Menschen sind fehlbar.“ Auf den ersten Blick könnte diese Aussage selbstwiderlegend wirken, weil:
- Die Person, die sie äußert, ist ebenfalls ein Mensch.
- Wenn sie fehlbar sind, dann könnte auch ihre Behauptung fehlbar sein – also möglicherweise falsch.
Doch genau hier liegt der Denkfehler! Fehlbarkeit bedeutet nicht, dass jemand immer falsch liegt – es bedeutet lediglich, dass man im Prinzip falsch liegen kann. Deshalb ist es entscheidend, dass wir auch auf die genaue Bedeutung der Begriffe achten – selbst dann, wenn Formulierungen wie ‚alle‘ oder ‚kein‘ auf Absolutheit hindeuten. Fehlbarkeit bedeutet die Möglichkeit eines Fehlers, nicht die Garantie eines Fehlers. Eine fehlbare Person kann also sehr wohl wahre Aussagen treffen. Damit eine solche Aussage sich selbst widerspricht, müsste sie lauten: „Alle Menschen sind immer fehlbar.“
Mit diesem Verständnis haben wir nun ein klareres Bild davon, was selbstwiderlegende Aussagen sind. Wir sind fast bereit, in das eigentliche Argument einzusteigen. Zuvor müssen wir jedoch noch einige Begriffe definieren und klären – das wird uns helfen, Missverständnisse und Unklarheiten im weiteren Verlauf zu vermeiden. Der erste dieser Begriffe ist „Metaphysik“.
2.4 Metaphysik
Metaphysik beschäftigt sich mit den grundlegenden Fragen zur Wirklichkeit – damit, was Existenz eigentlich ist und was es bedeutet, dass etwas real ist. Sie geht über das hinaus, was wir sehen, messen oder beobachten können, und stellt tiefgehende Fragen über Zeit, Raum, Bewusstsein, freien Willen und die grundlegende Beschaffenheit der Wirklichkeit. Oft merken wir es gar nicht, aber in vielen Fällen akzeptieren wir metaphysische Annahmen als wahr – ganz selbstverständlich und ohne es überhaupt zu bemerken.
Stellen wir uns vor, wir wären eine Figur in einem Videospiel, sagen wir, in einem Fantasie-Königreich. Wir sehen Objekte, interagieren mit anderen Charakteren, folgen den physikalischen Gesetzen der Spielwelt. Aber jetzt kommt der entscheidende Punkt: Wer oder was hat eigentlich den Code geschrieben, der all das möglich macht? Was liegt hinter dem Sichtbaren und sorgt dafür, dass alles funktioniert und überhaupt existieren kann?
Metaphysik ist so etwas wie der Blick hinter die Kulissen der Wirklichkeit – der Versuch, den „Code“ der Realität zu verstehen. Sie stellt die tiefsten und grundlegendsten Fragen überhaupt, wie zum Beispiel:
- Was ist Existenz überhaupt?
- Warum gibt es etwas und nicht vielmehr nichts?
- Was bedeutet es, dass etwas real ist?
- Haben wir freien Willen oder ist alles determiniert?
- Ist die Wirklichkeit nur das, was wir sehen können – oder steckt da noch mehr dahinter?
- Was ist Bewusstsein – und wie kann es überhaupt etwas geben, das bewusst ist?
- Existieren abstrakte Objekte – wie Zahlen – wirklich?
2.5 Metaphysik und Wissenschaft
Viele der metaphysischen Fragen wirken auf den ersten Blick so, als würden sie sich mit der Wissenschaft überschneiden. Doch obwohl es inhaltliche Berührungspunkte gibt, bleiben sie in ihrem Wesen philosophisch – also metaphysisch. Wie unterscheidet sich Metaphysik also von Wissenschaft, wenn doch beide darauf abzielen, die Wirklichkeit zu beschreiben? Wir haben bereits ansatzweise umrissen, was Metaphysik ist, aber es lohnt sich, den Unterschied zur Wissenschaft noch etwas klarer herauszuarbeiten. Die Philosophin Alyssa Ney bietet einen hilfreichen Zugang zu dieser Unterscheidung:
„Angenommen, die Physik sagt uns, dass die grundlegenden Bausteine der Materie Leptonen und Quarks sind. Die Metaphysikerin wird dann fragen: Gibt es nur diese physikalischen Objekte – oder existieren auch andere Arten von Entitäten? Zum Beispiel: Gibt es neben Elektronen und Quarks auch nicht-physikalische Dinge wie Geist oder Bewusstsein? Existieren außerdem abstrakte Objekte wie Zahlen oder Eigenschaften? Und neben konkreten und abstrakten Objekten – gibt es womöglich noch ganz andere Kategorien von Entitäten, wie etwa Ereignisse, Prozesse oder raumzeitliche Strukturen?“5
2.6 Brauchen wir Metaphysik?
Betrachten wir folgende Behauptung: „Wenn man etwas nicht wissenschaftlich testen oder messen kann, ist es bedeutungslos.“ Das klingt auf den ersten Blick ziemlich vernünftig – man denkt sich: „Genau! Wenn man es nicht beweisen kann, sollte man es auch nicht glauben!“ Aber genau hier liegt der fatale Denkfehler: Diese Aussage selbst ist nicht wissenschaftlich überprüfbar. Wir können diesen Grundsatz nicht durch Beobachtung oder Experiment belegen. Damit widerspricht sich die Aussage selbst – sie ist selbstwiderlegend. Damit Wissenschaft überhaupt in der Lage ist, uns irgendetwas über die Welt oder das Universum zu sagen, muss sie bestimmte metaphysische Voraussetzungen annehmen – quasi als „Startvoraussetzungen“, um überhaupt vom Boden abheben zu können. Zu diesen grundlegenden metaphysischen Voraussetzungen gehören unter anderem:
- Dass es eine reale, objektive Außenwelt gibt, unabhängig von unserem subjektiven Bewusstsein – anders gesagt: Die Welt, in der wir leben, ist keine Illusion wie in einem Videospiel oder der Matrix. Wissenschaft beruht auf Beobachtung durch unsere Sinne oder durch Instrumente. Wenn unsere Sinne aber getäuscht werden, wie können wir dann mit Sicherheit sagen, dass unsere wissenschaftlichen Theorien wirklich die reale Welt beschreiben?
- Die Verlässlichkeit unserer Sinneswahrnehmung – dieser Punkt hängt direkt mit dem vorherigen zusammen. Wenn wir unseren Sinnen nicht vertrauen können, wie sollen wir dann überhaupt irgendetwas wissen? Jeder Versuch, die Zuverlässigkeit unserer Sinne wissenschaftlich zu beweisen, würde wiederum unsere Sinne voraussetzen – was zu einem Zirkelschluss führt.
- Die Gleichförmigkeit der Natur – also die Annahme, dass Naturgesetze existieren und sich durchgängig in gleicher Weise verhalten. Ein Beispiel: Die Sonne ist bislang an jedem Tag der bekannten Geschichte aufgegangen. Aber garantiert das, dass sie auch morgen wieder aufgeht? Nicht unbedingt! Nur weil etwas bisher immer geschehen ist, heißt das nicht, dass es auch weiterhin geschehen muss. Die Wissenschaft setzt die Existenz solcher Gesetzmäßigkeiten voraus – sie kann aber nicht beweisen, dass diese Gesetze sich nicht plötzlich ändern.
- Die Existenz mathematischer und logischer Wahrheiten – auch das ist grundlegend: Mathematik und Logik stehen logisch vor jeder wissenschaftlichen Untersuchung. Wenn mathematische und logische Gesetze nicht zuverlässig beschreiben würden, wie Naturgesetze funktionieren, könnten wir nichts über die Welt wissen. Warum passen abstrakte mathematische Konzepte so erstaunlich gut zur realen Welt? Warum „gehorcht“ das Universum Gesetzen, die sich mathematisch ausdrücken lassen? Die Wissenschaft muss das einfach annehmen – jeder Versuch, diese Annahme wissenschaftlich zu beweisen, würde bereits die Gültigkeit von Mathematik und Logik voraussetzen.
Das sind nur vier Beispiele – es ließen sich noch viele weitere nennen. Doch der Punkt bleibt derselbe: Wissenschaft allein kann uns nicht alles über die Wirklichkeit sagen. Sie beruht selbst auf zahlreichen philosophischen – also metaphysischen – Voraussetzungen, um überhaupt Aussagen über die Realität machen zu können.
Genau solche Grundannahmen zeigen, dass Wissenschaft ohne ein philosophisches Fundament nicht auskommt. Wer verstehen will, warum Konzepte wie Wahrheit, Logik oder Kausalität überhaupt tragfähig sind, kommt um metaphysische Fragen nicht herum. Ohne diesen Hintergrund bleibt unklar, ob wir unserer eigenen Erkenntnisfähigkeit wirklich vertrauen können – oder nur so tun als ob. Im nächsten Schritt lohnt sich deshalb ein genauerer Blick auf die weltanschaulichen Voraussetzungen, auf denen viele moderne Denkansätze beruhen – insbesondere auf den Naturalismus.
2.7 Naturalismus und Metaphysik
Es ist sowohl ein logischer Fehler als auch ein begriffliches Missverständnis, den Naturalismus für eine wissenschaftliche Theorie zu halten. Der Naturalismus behauptet, dass alles, was existiert, aus natürlichen Entitäten und physikalischen Prozessen besteht. Doch der Naturalismus ist – seinem Wesen nach – eine metaphysische Theorie. Aber wie genau ist das gemeint? Und warum? Behalten wir diesen Gedanken einen Moment im Hinterkopf. In Abschnitt 1.4 haben wir gesehen, dass sich die Metaphysik mit den grundlegenden Schichten der Wirklichkeit beschäftigt. Wie in Abschnitt 1.6 deutlich wurde, bewegen sich metaphysische Konzepte oft außerhalb des Bereichs der Naturwissenschaften. Doch wie können wir dann überhaupt feststellen, ob solche Konzepte wahr oder falsch sind, wenn sie sich wissenschaftlich nicht überprüfen lassen?
Metaphysische Theorien werden nicht im Labor bewiesen, sondern durch sorgfältige Argumentation, begriffliche Analyse und den Vergleich mit konkurrierenden Erklärungsansätzen bewertet. Philosophinnen und Philosophen prüfen solche Theorien, indem sie deren logische Struktur analysieren, ihre Konsequenzen durch Gedankenexperimente testen und ihre Erklärungskraft mit alternativen Weltbildern vergleichen. Die beste metaphysische Theorie ist diejenige, die in sich stimmig ist, unnötige Komplexität vermeidet und die grundlegenden Aspekte der Wirklichkeit – wie Zeit, Bewusstsein oder Kausalität – am überzeugendsten erklärt. Dieser Prozess stützt sich auf abduktives und induktives Denken – ähnlich wie bei der Suche nach der besten Erklärung für ein Rätsel: Die Theorie, die möglichst viele Fakten auf möglichst einfache und kohärente Weise zusammenbringt, gilt als die stärkste. Auch wenn es hier keine empirischen Tests gibt, nutzen Philosophinnen und Philosophen diese Werkzeuge, um unser Verständnis von Wirklichkeit zu schärfen – und sicherzustellen, dass die Theorien, die wir akzeptieren, nicht nur intellektuell solide sind, sondern auch die überzeugendsten Erklärungen für die Welt liefern, wie wir sie erleben.
2.7.1 Naturalismus ist letztlich eine metaphysische Theorie
Stellen wir uns vor, wir wären eine Figur in einem Videospiel, in dem alles, was wir erleben – die Charaktere, die physikalischen Abläufe, sogar die Landschaften – innerhalb dieser Spielwelt existiert. Nun stelle man sich vor, jemand behauptet: „Außerhalb dieser Welt existiert nichts.“
Selbst wenn wir jeden Winkel des Spiels erkunden, könnten wir niemals über seine Grenzen hinaustreten, um zu überprüfen, ob es noch eine andere Welt außerhalb gibt. Wir wären vollständig an das Universum des Spiels und seine Regeln gebunden. Gerade bei solchen Vergleichen wird deutlich, dass es hier nicht nur um theoretische Fragen geht. Denn wenn wir nicht herausfinden können, ob es außerhalb des „Systems“ überhaupt noch etwas gibt, betrifft das letztlich auch unsere Überzeugungen darüber, was wir wissen können – und wie sicher dieses Wissen überhaupt ist. Naturalismus erscheint dann weniger als neutrale Beschreibung der Welt, sondern als Deutung mit eigenen blinden Flecken. Der nächste Schritt ist daher zu klären, welche Form von Wirklichkeitsverständnis unser Denken am besten erklären kann
Genau das ist vergleichbar mit dem, was der Naturalismus über unsere Wirklichkeit aussagt. Der Naturalismus vertritt die Ansicht, dass nur natürliche Entitäten und Prozesse existieren – mit anderen Worten: Alles, was real ist, gehört zur physikalischen, beobachtbaren Welt. Die Wissenschaft untersucht diese natürliche Welt mit Hilfe von Experimenten und Beobachtungen. Aber ähnlich wie die Spielfigur im Videospiel sind auch wir auf das beschränkt, was wir sehen, messen und testen können.
Warum also kann der Naturalismus nicht als wissenschaftliche Theorie im engeren Sinne bewiesen werden?
- Er ist eine Grundannahme: Wissenschaft setzt voraus, dass die natürliche Welt alles ist, was existiert – genau wie die Spielfigur davon ausgeht, dass nur die Spielwelt real ist. Diese Annahme wird einfach vorausgesetzt, sie ist nicht selbst das Ergebnis eines Experiments. Philosophinnen und Philosophen erkennen deshalb: Der Naturalismus ist kein empirischer Befund, sondern ein weltanschaulicher Ausgangspunkt, ein metaphysischer Rahmen, innerhalb dessen wissenschaftliches Arbeiten erst möglich wird.
- Das „Beweisen eines Negativen“ ist grundsätzlich problematisch: Um den Naturalismus zu beweisen, müsste man zeigen, dass es nichts jenseits der Natur gibt. Doch zu beweisen, dass etwas nicht existiert – zum Beispiel ein übernatürlicher Bereich oder eine transzendente Dimension – ist äußerst schwierig, wenn nicht sogar unmöglich. So wie wir das Videospiel nicht verlassen können, um zu sehen, ob es „draußen“ noch etwas gibt, kann die Wissenschaft nicht aus dem natürlichen Universum heraustreten, um zu überprüfen, ob wirklich nichts anderes existiert.
- Wissenschaft hat ihre Grenzen: Wissenschaft ist darauf ausgelegt, beobachtbare und messbare Phänomene zu untersuchen. Aber nehmen wir einmal abstrakte Objekte wie Zahlen oder mathematische Strukturen: Diese sind keine physischen Objekte, die mit Materie interagieren oder sich mit Instrumenten nachweisen lassen. Und doch haben sie offensichtlich stabile, verlässliche Eigenschaften, auf denen der Erfolg der Naturwissenschaften ganz wesentlich beruht.Wenn solche abstrakten Entitäten existieren – und es spricht vieles dafür – dann liegen sie außerhalb dessen, was empirisch getestet werden kann. Naturalismus ist also im Kern eine metaphysische Annahme über die Beschaffenheit der Wirklichkeit, kein Ergebnis experimenteller Forschung.
Kurz gesagt: Der Naturalismus bleibt eine metaphysische Theorie, weil er eine umfassende Aussage über die Gesamtheit dessen trifft, was existiert – eine Aussage, die sich der wissenschaftlichen Bestätigung oder Widerlegung entzieht. Zwar funktioniert die Wissenschaft hervorragend innerhalb des natürlichen Rahmens, doch sie beruht selbst auf grundlegenden Voraussetzungen – etwa der Verlässlichkeit unserer Sinne oder der Gleichförmigkeit der Natur –, die wir schlicht voraussetzen müssen. Der Versuch zu beweisen, dass außerhalb der Natur nichts existiert, wäre vergleichbar mit dem Versuch, das eigene Videospiel zu verlassen, um nachzuschauen, ob es noch eine „echte Welt“ dahinter gibt – eine unmögliche Aufgabe innerhalb des Systems, in dem wir uns befinden. Deshalb gilt es heute in der analytischen Philosophie und in der Wissenschaftstheorie weithin als anerkannte Position, dass die Behauptung, es existiere nur das Natürliche, keine wissenschaftlich bestätigte Hypothese, sondern eine metaphysische Grundhaltung ist. Wir haben nun gesehen, welche Rolle die Metaphysik innerhalb der Wissenschaft spielt, und dass der Naturalismus eine metaphysische Theorie ist. Wenden wir uns jetzt dem nächsten Begriff zu: Teleologie.
2.8 Teleologie
Teleologie – abgeleitet vom griechischen Wort „telos“ (τέλος), was so viel bedeutet wie „Ziel“, „Zweck“ oder „Ende“, sowie dem Suffix „-logia“ (-λογία), „Lehre von“ – ist ein philosophischer Begriff, der die Vorstellung bezeichnet, dass Dinge in der Welt einen Zweck haben oder auf ein bestimmtes Ziel hin ausgerichtet sind. Zur Veranschaulichung: Teleologie ist wie das Drehbuch eines Theaterstücks. Wenn wir an Teleologie glauben, gehen wir davon aus, dass das Universum – oder zumindest gewisse Dinge innerhalb des Universums, wie etwa das menschliche Leben – einem sinnvollen Plan folgen, der auf ein bestimmtes Ziel hin ausgerichtet ist. Wenn wir Teleologie ablehnen, sehen wir das Leben eher wie eine Improvisationsshow – ohne festes Skript, ohne vorher festgelegte Richtung. Die meisten Philosophinnen und Philosophen lehnen heute die Vorstellung von Teleologie ab – insbesondere Vertreter des Naturalismus. Denn im Rahmen des Naturalismus gibt es keinen Gott, keine „höhere Macht“ und auch kein „Naturgesetz“, das etwas auf ein finales Ziel oder einen Zweck hin ausrichtet. Natürliche Entitäten folgen schlicht und blind den physikalischen Gesetzmäßigkeiten – ohne Richtung, ohne Absicht, ohne Ziel.Der Philosoph Jim Slagle bringt das treffend auf den Punkt:
„Die moderne Wissenschaft wird im Allgemeinen so verstanden, dass sie mit dem Konzept der Finalursache abgeschlossen hat. Es gibt keinen Zweck, kein Ziel, keine Teleologie, die berücksichtigt werden müsste. Das Hauptargument dafür ist die biologische Evolution: Man sagt uns, dass die Evolution nicht mit Blick auf ein finales Ziel abläuft. Die natürliche Selektion ist der blinde Uhrmacher – blind deshalb, weil sie nicht vorausblickt, keine Folgen plant, kein Ziel vor Augen hat.“8
In Abschnitt 3. werden wir aufzeigen, welche tiefgreifende Bedeutung die Ablehnung von Teleologie hat – und warum genau diese Ablehnung ein ernsthaftes Problem für den Naturalismus darstellt. Diese Frage führt mitten ins Herz der weltanschaulichen Voraussetzungen, auf denen viele moderne Denkmodelle beruhen. Bis hierhin wurde deutlich, dass jede Form von Erkenntnis auf grundlegenden Voraussetzungen beruht, die selbst nicht empirisch überprüfbar sind. Weltanschauungen wie der Naturalismus beanspruchen, die Wirklichkeit umfassend zu erklären – doch sie stützen sich dabei auf Annahmen, die sie selbst kaum begründen können. Genau hier setzt der nächste Abschnitt an: Wenn der Naturalismus recht hätte, wäre unser Denken nicht mehr zuverlässig – auch nicht in Bezug auf den Naturalismus selbst.
Quellen:
1 Jim Slagle, The Epistemological Skyhook: Determinism, Naturalism, and Self-Defeat (New York: Routledge, 2016), 30.
2 Slagle, The Epistemological Skyhook, 30–31.
3 Graham Oppy, The Best Argument against God (London: Palgrave Macmillan, 2013), 6.
4 Graham Oppy and Kenneth L. Pearce, Is There a God? A Debate (New York: Routledge, 2022), 102–104.
5 Alyssa Ney, Metaphysics: An Introduction, 2nd ed. (London: Routledge, 2023), 29.