Mehr als Materie – Eine christliche Antwort auf den Naturalismus (3/3)

Kevin Gaa
veröffentlicht am 5.6.2025
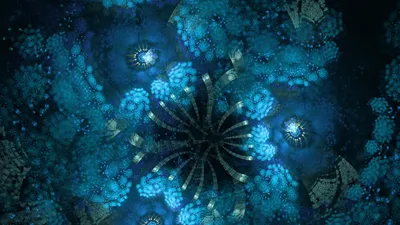
1. Rückblick auf Teil 1 & 2
m ersten Teil dieser dreiteiligen Artikelreihe haben wir zentrale Begriffe und Konzepte geklärt, die notwendig sind, um das Argument in Teil 2 vollständig zu verstehen. Dort wurde der Versuch unternommen zu zeigen, dass der Naturalismus – insbesondere in Verbindung mit einem evolutionären Weltbild – sich selbst untergräbt. Mit anderen Worten: Wer den Naturalismus annimmt, sägt an dem Ast, auf dem er sitzt. Der Grundgedanke: Die Evolution selektiert nur für empirisch nützliche Überzeugungen, also für solche, die entweder praktisches Überleben oder wissenschaftliche Erklärung fördern. Metaphysische Überzeugungen – etwa über die grundlegende Struktur der Realität – entstehen jedoch nicht auf dieselbe Weise. Sie sind nicht direkt beobachtbar und unterliegen keiner Rückkopplung, die anzeigt, ob sie wahr oder falsch sind.
Da aber der Naturalismus selbst eine metaphysische Überzeugung ist, untergräbt er sich selbst: Wenn unsere kognitiven Fähigkeiten nicht darauf ausgerichtet sind, metaphysische Wahrheiten zu erkennen, haben wir keinen guten Grund, dem Naturalismus zu vertrauen – selbst wenn er wahr wäre. Ein hilfreiches Bild: Wenn wir nur ein Thermometer hätten, dessen Zuverlässigkeit wir nicht kennen und das wir nicht überprüfen können – sollten wir seinen Messwerten vertrauen? Die naheliegende Antwort: Nein. Ebenso gilt: Wenn unsere kognitiven Fähigkeiten – besonders im Bereich abstrakter, metaphysischer Überlegung – nicht auf Wahrheit abzielen, dann sollten wir auch den Überzeugungen, die wir aus solchen Denkprozessen gewinnen, nicht blind vertrauen.Im letzten Teil dieser Reihe widmen wir uns nun verschiedenen Einwänden, die gegen das Argument aus Teil 2 vorgebracht werden könnten – und zeigen, warum keiner dieser Einwände das Argument wirklich entkräftet. Legen wir los.
2. Kann die Evolution verlässliche Überzeugungen über die letztendliche Realität hervorbringen?
Naturalisten argumentieren, dass evolutionäre Prozesse nicht nur die Zuverlässigkeit unserer kognitiven Fähigkeiten nahelegen, sondern tatsächlich sicherstellen könnten – und zwar nicht nur im Hinblick auf überlebensrelevante Wahrheiten, sondern auch im Bereich abstrakter Überzeugungen über die ultimative Wirklichkeit. Wenn die Evolution uns für das Überleben ausstattet, warum dann nicht auch für metaphysische Einsicht? Dieser evolutionsbasierte Einwand tritt in zwei Formen auf. Erstens: das Inhalt-Kausalitäts-Argument, dem zufolge wahre Überzeugungen direkt durch die Evolution selektiert werden. Zweitens: der Spill-over-Einwand, wonach zuverlässiges metaphysisches Denken ein unbeabsichtigtes Nebenprodukt allgemein nützlicher kognitiver Fähigkeiten ist. Beide verdienen eine kritische Prüfung.
2.1 Das Inhalts-Kausalitäts-Argument
Dieses Argument besagt, dass die Evolution Individuen bevorzugt, deren Überzeugungen mit der Realität übereinstimmen, weil wahre Überzeugungen das Überleben fördern. Ein Frühmensch, der korrekt glaubt, dass Tiger gefährlich sind, überlebt eher als jemand, der das Gegenteil glaubt. Daher sollte die Evolution kognitive Fähigkeiten begünstigen, die wahre Überzeugungen hervorbringen.1
Zunächst erscheint das plausibel: Akkurate Überzeugungen helfen Organismen, sich in ihrer Umwelt zurechtzufinden. Doch das Problem zeigt sich bei der Übertragung dieses Prinzips auf metaphysische Überzeugungen – denn diese haben selten Auswirkungen auf das Überleben. Ob jemand glaubt, dass die Realität rein physisch ist oder dass es nicht-physische Entitäten (wie Seelen) gibt, beeinflusst typischerweise nicht, wie er jagt, sammelt oder Kinder aufzieht. Stellen wir uns zwei Frühmenschengruppen vor – eine mit naturalistischer, die andere mit spiritueller Weltsicht –, die unter denselben Umweltbedingungen leben. Trotz ihrer metaphysischen Unterschiede sind beide im Überlebensalltag gleichermaßen erfolgreich. Die Evolution, blind gegenüber metaphysischer Wahrheit, hat keinen Grund, eine der beiden Weltanschauungen zu bevorzugen. Somit gibt es unter naturalistischen Voraussetzungen keinen Grund zu glauben, dass metaphysische Überzeugungen zuverlässig wahrheitsgemäß sind. Das untergräbt das Inhalt-Kausalitäts-Argument: Während evolutionäre Prozesse in praktischen Belangen zu wahren Überzeugungen führen mögen, bieten sie keine Garantie für die Zuverlässigkeit in abstrakten, metaphysischen Fragen. Der Naturalismus bleibt daher fragwürdig.
2.2 Der indirekte (Spill-over) Einwand
In Anerkennung dieser Begrenzung behauptet der Spill-over-Einwand, dass die Evolution indirekt zuverlässiges metaphysisches Denken ermöglicht. Kognitive Fähigkeiten wie Vorstellungskraft, Abstraktionsvermögen und Sprache – ursprünglich für das Überleben entwickelt – sollen später in Bereiche wie Philosophie und Religion übergegangen sein. Naturalisten verweisen auf die beeindruckenden intellektuellen Leistungen der Menschheit als Beleg dafür, dass unser allgemeines Denkvermögen auch in anderen Bereichen zuverlässig ist. Doch eine entscheidende Frage bleibt: Führt die Fähigkeit zu abstraktem Denken tatsächlich zu wahren Überzeugungen? Die Evolution selektiert Merkmale, die das Überleben fördern – nicht solche, die metaphysische Wahrheiten erzeugen. Selbst wenn wir durch evolutionäre Prozesse zu abstraktem Denken befähigt wurden, heißt das nicht, dass wir damit metaphysisch richtige Schlüsse ziehen können. Ein Mechanismus, der in einem Bereich – z. B. beim Werkzeugbau – nützlich ist, muss nicht zwangsläufig auch in einem anderen – wie metaphysischer Reflexion – zuverlässig sein, sofern dies nicht unabhängig überprüfbar ist. Ohne eine Methode zur Verifizierung, ob diese Spill-over-Fähigkeiten metaphysische Wahrheit erfassen, bleibt der Einwand unzureichend. Die Evolution bietet keinen Weg, die Genauigkeit unserer abstrakten Überzeugungen zu beurteilen – und der Naturalismus bleibt damit gegenüber der epistemischen Herausforderung verwundbar.
3. Können wissenschaftliche Methoden oder kulturelles Lernen unsere kognitiven Grenzen überwinden?
Im vorherigen Abschnitt haben wir gesehen, dass evolutionäre Erklärungsansätze – sowohl direkte als auch indirekte – nicht ausreichen, um die Zuverlässigkeit unserer metaphysischen Überzeugungen zu rechtfertigen. Die Evolution mag praktische, überlebensbezogene Kognition erklären, aber nicht unsere Fähigkeit, abstrakte Wahrheiten über die letztendliche Wirklichkeit – einschließlich des Naturalismus selbst – zu erfassen.
Um diesem Problem zu begegnen, verlagern manche Naturalisten den Fokus von der Evolution auf menschliche Kultur- und Wissensentwicklung. Sie argumentieren, dass Werkzeuge wie wissenschaftliches Denken, Peer-Review-Verfahren und logische Analyse – als Produkte kulturellen Fortschritts – unsere kognitiven Defizite kompensieren könnten. Selbst wenn die Evolution uns mit unsicheren Erkenntnisfähigkeiten ausgestattet hat, könnten wissenschaftliche Methoden uns heute helfen, unzuverlässige Überzeugungen in genauere zu überführen. Dieser Abschnitt untersucht zwei Hauptvarianten dieses kulturellen Einwands: Zunächst prüfen wir, ob wissenschaftliche Selbstkorrektur – durch Logik, Diskussion und Überprüfung – metaphysische Zuverlässigkeit gewährleisten kann. Danach bewerten wir das Argument, das sich auf den prädiktiven Erfolg der Wissenschaft beruft, um daraus Vertrauen in unser Weltbild abzuleiten.
3.1 Das Argument der wissenschaftlichen Selbstkorrektur
Dieses Argument geht davon aus, dass die Evolution uns zwar fehlerhafte kognitive Werkzeuge gegeben hat, die Wissenschaft jedoch selbstkorrigierende Verfahren – wie Experimente, Logik und Peer Review – entwickelt hat, um Fehler aufzudecken und zu beheben. Über Generationen hinweg sollen solche Praktiken unsere Überzeugungen auch in abstrakten Bereichen verfeinern. Dieses Argument bezieht seine Stärke aus den Erfolgen der modernen Wissenschaft. Menschen sind offenbar in der Lage, fehlerhafte Theorien zu überarbeiten und verborgene Wahrheiten zu entdecken. Durch rigorose Forschung haben wir ein Instrumentarium geschaffen, das darauf ausgelegt ist, Irrtümer zu eliminieren und unser Weltverständnis zu vertiefen. Allerdings tritt hier ein zentrales Problem auf: epistemische Zirkularität. Wissenschaftliche Methoden sind selbst Produkte unserer evolutionär geprägten Kognition. Sie zu verwenden, um die Verlässlichkeit eben jener Kognition zu beweisen, gleicht dem Versuch, eine Waage mit sich selbst zu wiegen. Ohne einen externen Maßstab können wir die Zuverlässigkeit unserer Werkzeuge nicht überprüfen. Unser Vertrauen in Logik oder Wissenschaft würde dann auf der unbewiesenen Annahme beruhen, dass unser Denken bereits vertrauenswürdig sei. Zur Veranschaulichung: Man stelle sich eine Gemeinschaft vor, die unbemerkt auf fehlerhaftem Denken beruht. Durch gegenseitige Bestätigung und innere Konsistenz verstärken sie ihre falschen Überzeugungen – ohne je den grundlegenden Irrtum zu erkennen. Ohne eine unabhängige Kontrollinstanz bleiben sie in ihrer Täuschung gefangen. Genau in dieser Zirkularitätsfalle steckt das Argument der wissenschaftlichen Selbstkorrektur, wenn es auf metaphysische Fragen angewendet wird. Fazit: Die Wissenschaft mag praktische Irrtümer korrigieren, doch sie kann nicht bestätigen, dass unsere kognitiven Fähigkeiten im metaphysischen Bereich grundsätzlich zuverlässig sind.
3.2 Das Argument aus dem prädiktiven Erfolg der Wissenschaft
Ein verwandter Einwand beruft sich auf die erstaunliche Vorhersagekraft der Wissenschaft. Naturalisten argumentieren, dass die Präzision moderner Physik, Biologie und Chemie ein Wunder wäre, wenn unsere geistigen Fähigkeiten nicht grundsätzlich zuverlässig wären. Daraus folge, dass wir den Methoden – und den metaphysischen Annahmen – hinter diesen Erfolgen vertrauen sollten. Das klingt zunächst überzeugend. Immerhin hat die Wissenschaft präzise Vorhersagen gemacht – von der Planetenbewegung bis hin zu Virusmutationen. Beweist dieser Erfolg nicht, dass unsere Kognition die Wirklichkeit korrekt abbildet? Nicht unbedingt. Prädiktive Stärke in empirischen Bereichen garantiert keine metaphysische Wahrheit. Die Geschichte zeigt, dass selbst funktionierende Theorien auf falschen metaphysischen Grundannahmen beruhen können. Das geozentrische Weltbild etwa konnte Himmelsbewegungen über Jahrhunderte vorhersagen – und war dennoch grundlegend falsch. Auch die Phlogiston-Theorie ermöglichte nützliche Voraussagen, verzerrte aber die chemische Wirklichkeit. Diese Beispiele zeigen: Praktischer Nutzen ist kein Garant für tiefere Wahrheit. Unsere heutigen Theorien mögen empirisch hilfreich, aber metaphysisch fehlerhaft sein. Die Wissenschaft ermöglicht Vorhersage und Manipulation – aber nicht zwangsläufig ein echtes Verständnis der letzten Wirklichkeit. Hinzu kommt: Wissenschaftliche Theorien beruhen oft auf unbeobachtbaren Annahmen und sind durch Daten unterdeterminiert – das heißt, mehrere Erklärungen können mit denselben Beobachtungen übereinstimmen. Ohne ein unabhängiges Kriterium zur Bewertung, welche Interpretation zutreffend ist, kann der Naturalismus aus dem Erfolg der Wissenschaft keine metaphysische Zuverlässigkeit ableiten.
4. Epistemische Regeln und das Problem, ein „Sollen“ aus einem „Sein“ abzuleiten
Nachdem wir evolutionäre und wissenschaftliche Verteidigungen des Naturalismus untersucht haben, wenden wir uns nun einer tiefergehenden Antwort zu – einer, die sich nicht darauf konzentriert, wie Überzeugungen durch Evolution oder Wissenschaft entstehen, sondern auf die Regeln des Denkens selbst. Gemeint sind damit die Prinzipien, die bestimmen, wie wir denken, Argumente bewerten und Überzeugungen bilden sollen. Dieser Ansatz ist entscheidend, denn die epistemische Herausforderung des Naturalismus hängt eng mit dem zusammen, was der Philosoph Thomas Crisp als das Prinzip der Vernunft bezeichnet: Wenn wir keine unabhängige Möglichkeit haben zu prüfen, ob unsere kognitiven Fähigkeiten in einem bestimmten Bereich zuverlässig sind, dann verlangt die Rationalität von uns, dass wir das Vertrauen in die dadurch hervorgebrachten Überzeugungen zurückhalten. Dieses Prinzip ist normativ – es sagt uns nicht, wie wir tatsächlich denken, sondern wie wir denken sollen. Naturalisten könnten darauf antworten, dass dieser Einwand verfehlt sei, weil er voraussetzt, dass es normative Regeln gibt, die der Naturalismus nicht rechtfertigen könne. Vielleicht, so das Argument, lassen sich diese Normen der Rationalität – also Regeln darüber, was wir glauben sollen – doch innerhalb eines naturalistischen Rahmens erklären. Falls ja, könnte der Naturalismus dem Vorwurf der Selbstwiderlegung entgehen.
4.1 Warum die normative Natur epistemischer Regeln entscheidend ist
Epistemische Regeln leiten unser Denken in allen Bereichen. Beispiele dafür sind:
• Wir sollen uns an Beweise halten.
• Wir sollen Widersprüche vermeiden.
• Wir sollen kohärente Überzeugungen bevorzugen.
Diese Regeln sind keine bloßen Beschreibungen, wie Menschen tatsächlich denken – sie sind Normen: Sie sagen uns, wie wir denken sollten, wenn wir gut und rational denken wollen. Diese Unterscheidung zwischen deskriptiven Aussagen („sein“) und normativen Aussagen („sollen“) ist zentral.
4.2 Das Is-Ought-Problem
Wie David Hume berühmt feststellte, lässt sich aus einem „Sein“ kein „Sollen“ ableiten. Nur weil Menschen bestimmte Verhaltensweisen oder Denkgewohnheiten evolutionär entwickelt haben, heißt das nicht, dass sie diese auch weiterhin befolgen sollten. Beispiel: Die Tatsache, dass Menschen zur Täuschung neigen, rechtfertigt nicht, dass sie täuschen sollten. Genau hier liegt ein ernstes Problem für den Naturalismus, der seinem Wesen nach deskriptiv ist. Er beschreibt die Welt durch physikalische Prozesse, nicht durch normative Vorgaben oder Verpflichtungen. Aber vernünftiges Denken setzt gerade solche Normen voraus – und der Naturalismus muss erklären, woher diese kommen.
4.3 Die Strategie des Naturalismus
Naturalisten behaupten meist, dass epistemische Regeln einfach erfolgreiche Denkmuster sind, die sich evolutionär oder kulturell herausgebildet haben. Logik zu folgen oder sich auf Beweise zu stützen, hilft uns, zu überleben, zusammenzuarbeiten und zu gedeihen – und so haben sich diese Muster mit der Zeit etabliert und wurden als „Normen“ anerkannt. Nach dieser Sichtweise sind epistemische „Sollens“-Aussagen letztlich bloße Konventionen oder Praktiken, die sich als nützlich erwiesen haben. Sie sind nicht in etwas Tieferem verwurzelt als in ihrer praktischen oder historischen Nützlichkeit.
4.4 Warum das keine echte Normativität begründet
Das Problem ist: Erfolg ersetzt keine Vorschrift. Selbst wenn bestimmte Denkgewohnheiten evolutionär oder sozial vorteilhaft sind, heißt das nicht, dass wir sie deshalb befolgen sollen – insbesondere nicht in abstrakten Bereichen wie der Metaphysik. Stellen wir uns eine Denkgewohnheit vor, bei der unbequeme Wahrheiten ignoriert werden, weil das zu mehr sozialer Harmonie und psychischer Stabilität führt. Selbst wenn das zu größerem Fortpflanzungserfolg führen würde – würden wir deshalb sagen, man sollte die Wahrheit ignorieren? Offensichtlich nicht. Der evolutionäre oder soziale Erfolg einer Gewohnheit erzeugt keine epistemische Verpflichtung. Echte epistemische Regeln beanspruchen eine verbindliche Geltung, die über bloße Nützlichkeit hinausgeht. Sie fordern uns dazu auf, ihnen zu folgen – nicht nur, weil sie sich als nützlich erwiesen haben, sondern weil es richtig ist, ihnen zu folgen. Wer sie lediglich als „nützliche Muster“ beschreibt, nimmt ihnen genau diese normative Kraft.
4.5 Zurück zur Selbstwiderlegung
Damit steht der Naturalismus erneut vor dem Problem epistemischer Selbstwiderlegung. Das Argument beruht auf normativen Regeln wie dem Prinzip der Vernunft – doch der Naturalismus, der sich einer rein deskriptiven Weltsicht verpflichtet hat, kann diese Normen nicht rechtfertigen. Um sie zu verwenden, müsste er sich bei einem nicht-naturalistischen Rahmen bedienen. Der Naturalismus steht somit vor einem Dilemma: Entweder er gibt zu, dass er epistemische Normen nicht begründen kann – und untergräbt damit seine eigene rationale Glaubwürdigkeit. Oder er importiert stillschweigend nicht-naturalistische Standards – und widerspricht damit seinem eigenen Weltbild. In beiden Fällen bleibt der Naturalismus instabil.
5. Epistemische Regeln und das Problem, ein „Sollen“ aus einem „Sein“ abzuleiten
Nachdem wir evolutionäre, wissenschaftliche und epistemologische Verteidigungen des Naturalismus betrachtet haben, wenden wir uns nun einer letzten Art von Einwand zu – solchen, die die Struktur oder Logik des Selbstwiderlegungsarguments selbst in Frage stellen. Diese Einwände verteidigen den Naturalismus nicht durch positive Erklärungen zur kognitiven Zuverlässigkeit. Stattdessen behaupten sie, dass das Argument in seiner Form fehlerhaft sei – und daher unabhängig von der Stichhaltigkeit des Naturalismus nicht trägt. Wir betrachten zwei zentrale strukturelle Einwände:
1. Die Behauptung, das Argument wechsle unzulässig von einer niedrigen Wahrscheinlichkeit zu Unbeurteilbarkeit (Inscrutability).
2. Die Behauptung, das Argument sei selbstwiderlegend, da es sich auf eben jene kognitiven Fähigkeiten stütze, die es in Zweifel zieht.
5.1 Von niedriger Wahrscheinlichkeit zu Unbeurteilbarkeit
Frühere Versionen des Selbstwiderlegungsarguments – etwa Alvin Plantingas EAAN – gingen davon aus, dass unter dem Naturalismus die Wahrscheinlichkeit, über zuverlässige kognitive Fähigkeiten zu verfügen, gering sei. Kritiker bemerken nun, dass neuere Versionen stattdessen auf Unbeurteilbarkeit (inscrutability) abstellen – also auf die These, dass wir unter naturalistischen Voraussetzungen gar nicht beurteilen können, ob unsere kognitiven Fähigkeiten zuverlässig sind. Diese Verschiebung, so der Vorwurf, schwäche das Argument oder stelle ein stilles Zurückweichen angesichts der Kritik dar. Doch dieser Einwand verkennt die logische Struktur des Arguments. Tatsächlich ist Unbeurteilbarkeit möglicherweise sogar stärker als ein Wahrscheinlichkeitsargument. Ein „low-probability“-Argument setzt eine messbare (wenn auch geringe) Chance der Unzuverlässigkeit voraus – und benötigt positive Evidenz. Unbeurteilbarkeit hingegen besagt, dass wir überhaupt kein Mittel haben, die Zuverlässigkeit zu beurteilen – weder im Positiven noch im Negativen. Und genau das macht die Argumentation so stark: Wenn wir die Zuverlässigkeit nicht beurteilen können, verlangt die Rationalität, dass wir unser Vertrauen aussetzen. Das lässt sich etwa mit einem Thermometer vergleichen, dessen Kalibrierung unbekannt ist: Wenn wir nicht wissen, ob es korrekt misst, haben wir keinen Grund, seinen Anzeigen zu vertrauen – selbst wenn es nicht nachweislich falsch ist. Ebenso gilt: wenn wir keine Möglichkeit haben, die Zuverlässigkeit unserer Vernunft einzuschätzen reicht bereits die Unsicherheit, um vernünftigerweise das Vertrauen zu verweigern. Die Umstellung auf Unbeurteilbarkeit ist also kein Rückzug, sondern eine Präzisierung und Stärkung des Arguments. Sie zwingt Naturalisten nicht nur dazu, Unzuverlässigkeit zu verneinen, sondern auch eine positive Begründung für die Zuverlässigkeit unserer Kognition zu liefern – etwas, das der Naturalismus bislang nicht geleistet hat.
5.2 Das Problem der doppelten Niederlage oder Selbstwiderlegung
Der zweite Einwand behauptet, dass sich das Selbstwiderlegungsargument selbst untergräbt:
Wenn man unter dem Naturalismus der eigenen Vernunft nicht trauen kann, dann kann man auch dem Argument selbst nicht trauen – was zu einem erkenntnistheoretischen Stillstand führen würde. Auf den ersten Blick wirkt das wie eine überzeugende Zurückweisung. Aber dabei wird übersehen, wie das Argument eigentlich aufgebaut ist: Es geht sozusagen nach dem Motto „Angenommen, der Naturalismus stimmt – was folgt daraus?“ Und genau da zeigt sich, dass dieses Weltbild sich selbst widerspricht und nicht wirklich standhält. Das Argument setzt nicht voraus, dass unsere Vernunft innerhalb des Naturalismus zuverlässig ist. Vielmehr lautet der Gedankengang: Wenn der Naturalismus wahr ist, dann können wir keiner Überzeugung trauen – auch nicht dem Naturalismus selbst. So wird eine Inkohärenz innerhalb des Naturalismus offengelegt, nicht innerhalb des Arguments. Zur Veranschaulichung: Stell dir ein Thermometer vor, auf dem steht: „Vertraue diesem Thermometer niemals.“ Diesen inneren Widerspruch aufzuzeigen, erfordert nicht, dass man den angezeigten Messwert glaubt. Genauso gilt: Um zu zeigen, dass der Naturalismus sich selbst zerstört, muss man nicht die Denkprozesse bejahen, die der Naturalismus selbst als unzuverlässig erscheinen lässt. Fazit: Das Selbstwiderlegungsargument ist nicht selbstwiderlegend – es legt lediglich einen fatalen inneren Widerspruch im naturalistischen Weltbild offen.
6. Zusammenfassung – Der epistemische Selbstwiderspruch des Naturalismus
Nachdem wir vier zentrale Verteidigungsstrategien des Naturalismus geprüft haben – evolutionäre Erklärungen, wissenschaftliche Methoden, epistemische Regeln und strukturelle Einwände – zeigt sich ein klares Ergebnis: Keine dieser Strategien kann verhindern, dass der Naturalismus in eine Selbstwiderlegung führt. In jedem Fall bleibt der Naturalismus unfähig, die Zuverlässigkeit unserer metaphysischen Überzeugungen konsistent zu begründen – einschließlich des Glaubens an den Naturalismus selbst.
6.1 Die Evolution bietet keine epistemische Garantie
Die Argumente, die sich auf evolutionäre Prozesse stützen – ob direkt (über Selektion wahrer Überzeugungen) oder indirekt (über das Spill-over abstrakter Fähigkeiten) – scheitern daran, Verlässlichkeit in metaphysischen Fragen zu gewährleisten. Evolution erklärt, wie unser Denken entstand, aber nicht, ob es in abstrakten Bereichen wahrheitsleitend ist. Da metaphysische Überzeugungen selten Auswirkungen auf Überleben und Reproduktion haben, fehlt der Evolution jeglicher Anreiz, solche Überzeugungen korrekt zu formen. Wir haben deshalb keine Grundlage, um unter Naturalismus Vertrauen in unsere metaphysischen Urteile zu haben.
6.2 Wissenschaftliche Methoden beheben das Problem nicht
Auch der Verweis auf Wissenschaft und kulturelles Lernen bietet keine tragfähige Lösung. Zwar korrigiert Wissenschaft viele Fehler, aber sie ist selbst Produkt unserer kognitiven Fähigkeiten. Wenn diese Fähigkeiten unter Naturalismus in metaphysischen Fragen unzuverlässig sind, dann können auch wissenschaftliche Methoden keine unabhängige Bestätigung bieten – sie basieren ja auf denselben fragwürdigen Grundlagen. Hinzu kommt, dass der prädiktive Erfolg der Wissenschaft auf beobachtbaren Phänomenen beruht und nichts über die Wahrheit metaphysischer Annahmen aussagt. Theoriegeschichte zeigt, dass nützliche Vorhersagen und falsche metaphysische Grundlagen durchaus zusammengehen können. Damit bleibt der epistemische Grund, naturalistische Weltanschauungen für wahr zu halten, weiterhin unklar.
6.3 Der Naturalismus kann normative Denkregeln nicht rechtfertigen
Ein besonders tiefgreifendes Problem liegt in der Unfähigkeit des Naturalismus, echte normative Regeln des Denkens zu begründen. Rationales Denken erfordert Verpflichtungen – etwa, dass man Widersprüche vermeiden und Beweise berücksichtigen soll. Der Naturalismus ist jedoch rein deskriptiv: Er beschreibt, wie Dinge sind, nicht wie sie sein sollen. Der Versuch, Normen als nützliche Denkgewohnheiten zu erklären, verfehlt den Punkt: Aus Nützlichkeit folgt keine normative Verbindlichkeit. Der Naturalismus nutzt epistemische Normen, kann sie aber nicht begründen – ein klassischer Fall von Selbstwiderspruch.
6.4 Strukturelle Einwände gegen das Argument scheitern
Zwei populäre strukturelle Einwände – der Übergang von geringer Wahrscheinlichkeit zu Unerkennbarkeit und der angebliche Selbstwiderspruch des Arguments – können den Naturalismus ebenfalls nicht retten. Im Gegenteil: Der Übergang zu Unerkennbarkeit stärkt das Argument, da er zeigt, dass selbst bei fehlender negativer Evidenz schon das Nichtwissen über Zuverlässigkeit rationales Misstrauen erzwingt. Und das Argument selbst ist kein Selbstwiderspruch, sondern ein reductio ad absurdum: Es nimmt den Naturalismus hypothetisch an und zeigt, dass er sich selbst untergräbt. Dafür ist kein Vertrauen in naturalistische Kognition notwendig – nur logische Konsistenzprüfung.
6.5 Fazit: Der Naturalismus bleibt instabil
Der Versuch, den Naturalismus zu retten, ist gescheitert. Weder Evolution, noch Wissenschaft, noch kulturelles Lernen, noch strukturelle Verteidigungslinien können erklären, warum wir unseren metaphysischen Überzeugungen trauen dürfen, wenn der Naturalismus wahr ist. Und doch basiert jede Weltanschauung – auch der Naturalismus – auf solchen Überzeugungen. Was bleibt, ist ein grundlegender Selbstwiderspruch: Der Naturalismus ist auf Denkregeln und Überzeugungsvertrauen angewiesen, die er nicht selbst zu rechtfertigen vermag. Wer den Naturalismus ernst nimmt, kann ihn nicht rational glauben – weil er sich selbst die erkenntnistheoretische Grundlage entzieht. Wenn unser Denken unter Naturalismus nicht rational begründet werden kann, dann können auch unsere Überzeugungen über den Naturalismus nicht rational begründet werden. Die Konsequenz ist klar: Will man rationale, begründete metaphysische Überzeugungen – etwa über die Natur der Realität –, muss man über den Naturalismus hinausdenken. Das bedeutet nicht, dass alle Weltanschauungen mit diesem Problem kämpfen. Vielmehr legt die Analyse nahe, dass jede Sichtweise, die metaphysisches Vertrauen beansprucht, eine plausible Erklärung für die Verlässlichkeit unserer kognitiven Fähigkeiten liefern muss – insbesondere in Bezug auf abstrakte, nicht-beobachtbare Wahrheiten. Ein Beispiel für ein solches alternatives Weltbild ist der christliche Theismus. In dieser Sicht ist der menschliche Geist nicht das zufällige Produkt blinder Naturkräfte, sondern Ausdruck eines rationalen, personalen Ursprungs. Das Universum ist, in dieser Perspektive, nicht geistlos, sondern beruht auf einem Fundament von Vernunft, Bedeutung und Absicht. Vor diesem Hintergrund ist es nachvollziehbar, warum unsere kognitiven Fähigkeiten auf Wahrheit ausgerichtet sein könnten – nicht nur in praktischen, sondern auch in metaphysischen Fragen. Ob diese Sichtweise letztlich die bessere Erklärung liefert, ist eine tiefgreifende philosophische Frage – und würde einen eigenen Artikel für sich erfordern.Was sich jedoch mit einiger Klarheit sagen lässt, ist: Der Naturalismus steht vor einer erheblichen erkenntnistheoretischen Herausforderung, die er bislang nicht überzeugend überwinden konnte. Weltanschauungen, die Geist, Vernunft und Wahrheit nicht als bloße Nebenprodukte physikalischer Abläufe verstehen, scheinen – zumindest auf den ersten Blick – besser aufgestellt, um erkenntnistheoretische Normen und kognitive Verlässlichkeit zu begründen.
1 Jim Slagle, The Epistemological Skyhook: Determinism, Naturalism, and Self-Defeat (New York: Routledge, 2016), 187.
2 Thomas M. Crisp, “On Naturalistic Metaphysics,” in The Blackwell Companion to Naturalism, ed. Kelly James Clark (Hoboken, NJ: Wiley-Blackwell, 2016), 64.